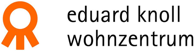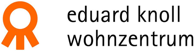14.02.2013
Das Wunsch- und Wahlrecht muss maßgebend sein
Fragen an Norman Weyrosta, den Geschäftsführer des Eduard-Knoll-Wohnzentrums (EKWZ) , einer Tochtergesellschaft des BSK e.V. in Krautheim. Dort wird neben anderen Wohnformen auch Betreutes Wohnen angeboten.
Herr Weyrosta, was ist das Besondere am Betreuten Wohnen (BW)?
Die Ziele des Betreuten Wohnens sind klar definiert: Es soll ein höchstmögliches Maß an Eigenständigkeit erreicht werden - bis hin zum dauerhaften Wohnen ohne fachliche Begleitung und Unterstützung. Es soll zur Selbstständigkeit befähigen, die eigene Handlungskompetenz stärken sowie die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen. Auch Eigenverantwortlichkeit und Entscheidungsfähigkeit sollen gefördert werden, Selbstbestimmung spielt also eine zentrale Rolle. Solche Anforderungen stellt auch die UN-Behindertenrechtskonvention. Wichtig für uns ist es deshalb, ein vielschichtiges und vielseitiges Angebot zu machen, das alle Wünsche abbilden kann. Ebenso wichtig ist die Möglichkeit des Wechsels innerhalb der angebotenen Wohnformen, falls sich die Lebensumstände ändern sollten.
Was unterscheidet das Betreute Wohnen von anderen Wohnformen?
Das Betreute Wohnen ist ein Zwischenschritt zwischen stationärer Heimunterbringung und autonomem Wohnen, gegebenenfalls mit ambulanter Versorgung.
Der Schwerpunkt liegt auf einer sozialpädagogischen Betreuung mit dem Ziel, notwendige Hilfen, Organisation, Beratung, Unterstützung und Anleitung zu koordinieren sowie bürgerschaftliche Hilfen zu vermitteln. Beispiele hierfür sind die Einbeziehung der Kirchengemeinde, von Vereinen und ehrenamtlicher Helfer bzw. die Nachbarschaftshilfe.
Sehen Sie darin eine zukunftsträchtige Wohnform?
Unbedingt. Das Angebot des ambulant betreuten Wohnens wird mit dem Ziel ausgebaut, den Umbau des Leistungssystems zu befördern und stationäre Leistungen auf das notwendige Maß zu begrenzen.
Wichtig ist dabei, dass auch andere Leistungsangebote der Eingliederungshilfe hierzu kompatibel sein müssen, z. B. die Regelungen zum Persönlichen Budget. In Baden-Württemberg gibt es hierzu einen Landesrahmenvertrag, der seit Mai 2012 auch auf die UN-Behindertenrechtskonvention Bezug nimmt.
Welche Vor- und Nachteile hat das Betreute Wohnen für Betreiber wie das EKWZ?
Ein Vorteil für uns ist zunächst, dass wir damit einer allgemeinen Entwicklung der Nachfrage folgen können. Die Nachfrage nach stationärer Versorgung besteht zwar nach wie vor, ist aber seit Jahren rückläufig. Im Gegenzug steigt die Nachfrage nach Wohnformen mit ambulanter Versorgung. Wir bekennen uns klar zur Devise „ambulant vor stationär“, fordern dies aber auch dann ein, wenn ambulante Versorgung mehr kostet als eine stationäre. Das Wunsch- und Wahlrecht von Menschen mit Behinderung muss maßgebend sein, nicht die Kostenfrage. Im Betreuten Wohnen sind Wohnen, Pflege und Betreuung jeweils durch eigene, getrennte Verträge mit den Bewohnern geregelt. Die Bewohner sind in der Wahl des Dienstleisters völlig frei. Das heißt, wir müssen uns der Konkurrenz stellen und durch gute Arbeit überzeugen, sonst ist der Kunde verloren. Schwieriger als im stationären Bereich ist die Personalorganisation und deren Finanzierung. Konkrete Personaleinsätze können abgerechnet werden, jedoch nicht das Vorhalten von Personal für den Fall, dass es gebraucht wird. Auf diesen Kosten bleibt man im Normalfall sitzen, durch die Anbindung an das Eduard-Knoll-Wohnzentrum lässt sich das aber ganz gut lösen, indem wir auf den dort vorhandenen Personalpool zurückgreifen können.
Interview UM
Quelle: LEBEN & WEG 1/2013
1764 Aufrufe